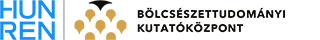Leírás és Paraméterek
Der Katalog der mittelalterlichen Bronzen des Ungarischen Nationalmuseums enthält die Bronzegegenstände in der Goldschmiedesammlung der Mittelalter Abteilung. Die eindeutig scheinende, gut umgrenzte inhaltliche Bestimmung hat im Laufe der Arbeit zahlreiche Fragen aufgeworfen, die auf Erklärungwarten. Bei der Festlegung der Zeitgrenzen wurden die in der ungarischen Geschichtsschreibung und Kulturgeschichte allgemein benutzten Zeitpunkte zugrunde gelegt. Demgemäß begann das imgarische Mittelalter mit der Staatsgründung im Jahre 1000, während sein Ende vom Untergang des selbständigen feudalistischen Königreiches, von der zum Zerbrechen des Landes in Teile und zur jahrhundertelangen Türkenherrschaft über einen großen Teil führenden verlorenen Schlacht bei Mohács 1526 bezeichnet wird. Diese Epochengrenzen überschreitet das Material des Katalogs nur in wenigen Fällen, bei einigen byzantinischen Reliquiar-Pektoralkreuzen, welche in Gräbern aus dem - in der ungarischen Geschichte als „Landnahmezeit" bezeichneten - 10. Jahrhundert gefunden wurden. Da sie sich aber weder nach Fonn noch Herkunft von den ähnlichen Gegenständen zumeist aus dem11. Jahrhundert unterscheiden, wurden sie der Vollständigkeit halber mit in den Katalog aufgenommen. Die auf dem Material der Gegenstände beruhende Inhaltsbestimmung warf schon weit mehr Probleme auf. Die mit dem klassischen Verfahren der Bronzebearbeitung, dem Guß, verfertigten Gegenstände (Pektoralkreuze, Prozessionskreuze, Leuchter, Aquamanilen, Räuchergefäße und Mörser) bilden den überwiegenden Teil des Katalogs. Ohne besondere Erklärung lassen sich zu ihnen noch einige bronzene Prägestöcke der Sammlung zählen und die nach Zeugnis der erhaltenen Stücke ausschließlich aus Bronze verfertigten Buch- und Pfcrdegeschirrbeschlägc. Eindeutig zum Themenkreis des Katalogs gehören die aus Bronze gegossenen Zitationssiegel, die einen nur im ungarischen Metallhandwerk vorkommenden, mit der heimischen Rechtsgeschichte zusammenhängenden Gegenstandstyp vertreten. Etwas willkürlich winden zu ihnen das doppelte Typarium (Petschaft für Wachssiegel) der Latiner von Esztergom (Kat. Nr. 213) hinzugerechnet, gehören doch die Typarien im allgemeinen nicht zum Bronzehandwerk. Die einzige Erklärung für seine Aufnahme in den Katalog ist, daß das zur frühesten Sammlung des Nationalmuseums gehörende, nach Alter und Herstellungsort eindeutig bestimmbare Petschaft ein einzigartig niveauvolles Werk der ungarischen königlichen Münzpräger aus Bronze ist. Die in ganz Europa verbreiteten, aus Bronzeblech gepreßten, gravurverzierten Handwaschschüsseln gehören - folgt man der Praxis der internationalen Fachliteratur - eindeutig zum Themenkreis des Katalogs. Nicht aufgenommen wurden dagegen sonstige liturgische Gegenstände aus Bronze- und Kupferblech, Kelche, Patenen, Ziborien und Monstranzen, weil sie hinsichtlich Form und Verzierungsweise - eher für die Goldschmiedekunst als für das Bronzehandwerk typisch sind. Ausnahmen stellen das einzige Räuchergefäß der Sammlung (Kat. Nr. 206) und einige Altarkreuze (Kat. Nr. 62,64,65) aus Kupferblech dar, welche als Ergänzung je einer größeren Gegenstandsgruppe aufgenommen winden. Ein ähnliches Problem stellte die Auswahl der zur Tracht gehörigen Gegenstände dar, da diese nicht in erster Linie ihr Material bestimmt, sondern der gesellschaftliche Rang ihres Trägers. Die Schmuckstücke und Klciderverzierungen aus Edelmetall der oberen Gesellschaftsschichten ahmte das Gemeinvolk aus billigerem Material, aber mit ähnlicher Fonn und Verzierung nach. Es war offensichtlich, daß z. B. die Fingerringe aus Bronze nicht in dieser Arbeit veröffentlicht werden können. Ebenso verhält es sich mit den Kleider- und Gürtelschnallen, einige Bronzeschnallen der Sammlung unterscheiden sich in nichts vom Silberschmuck ähnlichen Alters. Ihre Aufnahme geschah aus dem einzigen Grund, daß der Fingerring-Katalog des Ungarischen National museums -nach dem Vorbild anderer großer Sammlungen - vermutlich früher oder später erscheinen wird, aber diese bescheidenen, zumeist unpublizierten Bronze schnallen anderswo kaum zur Veröffentlichimg kommen werden. Einer Erklärung bedarf die Darstellung des sehr bedeutenden Materials aus Limoges in diesem Katalog. Die Entscheidung beruhte nicht bloß darauf, daß es sich um Bronzen handelt, sondern in erster Linie auf ihrer Rolle in der Geschichte des ungarischen Metallhandwerks. Der 1241 über das ganze Land hinweggehende und gewaltige Verwüstungen venir sachende Mongolen stürm hinterließ hunderte zerstörte und ausgeraubte Kirchen. Der Wiederaufbau und der Ersatz der für die Liturgie unerläßlichen Gegenstände fiel in jene Zeit, als die Werkstätten von
Limoges in großen Massen ihre Handelswaren produzierten. Das sehr bedeutende - und sich bei archäologischen Freilegungen ständig vermehrende - Limousiner Material ist also schon im 13. Jahrhundert nach Ungarn gekommen und zum organischen Bestandteil der damaligen Sachkultur geworden. An einer Reihe von Werken des heimischen Bronzehandwerks läßt sich der direkte Einfluß der Limousiner Importgegenstände nachweisen, oftmals gemischt mit den lokalen Traditionen. Und schließlich wurden die erstrangig wichtigen Schöpfungen des Bronzegusses, die Glocken, deshalb nicht in den Katalog aufgenommen, weil über sie vor kürzerer Zeit eine das gesamte ungarische Material bearbeitende Zusammenfassung von Pál Patay, Corpus campanarum antiquarum Hungáriáé (Budapest 1989), erschienen ist. Die im Katalog mitgeteilten mehr als dreihundert Stücke wurden nach Gegenstandstypen gruppiert, die im großen und ganzen der Chronologie des Erscheinens der einzelnen Typen folgen. Innerhalb der Gruppen bemühten wir uns gleichfalls, der Chronologie der Herstellung der Gegenstände zu folgen, wobei wir die einheimischen nicht von den Importgegenständen absonderten. Das dargebotene Material ist sowohl in seiner Zusammensetzung als auch in seinem Niveau außerordentlich heterogen. Neben einigen Stücken von herausragender Qualität ist der Anteil hinsichtlich ihres künstlerischen Wertes imbedeutender Massenware sehr hoch. Dies spiegelt einerseits den Charakter des ungarischen Bronzehandwerks wider, andererseits hat es historische und museumsgeschichtliche Gründe. Das völlige Fehlen von Spuren monumentaler Bronzewerke verweist darauf, daß im Mittelalter in Ungarn wahrscheinlich keine bronzenen Grabmäler, Lesepulte, Tore und - vor dem 14. Jahrhundert Taufbecken entstanden, wenn aber doch, dann wurden sie in den Kriegen der das Mittelalter abschließenden hundertfünfzigjährigen Türkenbesetzung vernichtet. Die aus historischen Quellen bekannten lebensgroßen Königsstatuen, die im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts vor dem Dom von Großwardein/Nagyvarad/Oradea aufgestellt worden waren, entfernten die Türken, um Kanonen daraus zu gießen. Eine einzige Arbeit der Schöpfer der in der europäischen Kunstgeschichte bahnbrechenden monumentalen Plastiken, der Bildhauer Márton und György Kolozsvári, blieb bis heute erhalten, die Reiterstatue St. Georgs im Prager Hradschin. Ebenso aus Quellenangaben kennen wir die bronzenen Brunnenfiguren in König Matthias' (1458-1490) Budaer Palast und weitere Werke aus Erz, die - außer zwei im Istanbuler Topkapi-Museum bis heute vorhandenen monumentalen Leuchtern - vermutlich sämtlich eingeschmolzen wurden. Das bestimmende neuzeitliche Ereignis der Bronzesammlung des Nationalmuseums war, daß nach dem Ersten Weltkrieg das damals bereits einige Jahrzehnte bestehende Kunstgewerbemuseum mit dem Nationalmuseum verschmolzen wurde. Mehr als zwei Jahrzehnte später trennte man die beiden Institutionen wieder, wobei man die Sammlungen so verteilte, daß die mit der ungarischen Geschichte zusammenhängenden oder sicher von ungarischen Meistern gefertigten bzw. als ungarische Funde ans Licht gekommenen Objekte ins Nationalmuseum und die sonstigen Schöpfungen des europäischen Kunstgewerbes ins Kunstgewerbemuseum kamen. Zu letzteren gehörten unter anderem die italienischen und französischen reich verzierten Mörser, Glöckchen und anderweitigen plastischen Schöpfungen, die emaillebemalten Gefäße aus Limoges, aber auch einige Limousmer Gegenstände aus dem 13. Jahrhundert, die nicht als ungarische Funde galten. Im Laufe des Zweiten Weltkrieges litten die Sammlungen des Nationalmuseums erheblichen Schaden, teils verschwanden sie, wurden durchemandergebracht, einige Depots brannten aus. In der nach dem Krieg vorgenommenen großen Revision wurden die Stücke gemäß der Inventarbücher identifiziert und die nicht identifizierbaren seit 1955 erneut inventarisiert. Natürlich konnte man vor allem jene Gegenstände identifizieren, über die es detaillierte und genaue Inventarbuchbeschreibungen bzw. auch Zeichnungen oder Fotos gab. Aufgrund der in scharfem Tempo vorgenommenen riesigen Arbeit der Revision nach dem Krieg wurde die Identifizierung fast bis heute weitergeführt; von daher stammen die doppelten Inventarnummern der Gegenstände, bei denen es nach der erneuten Inventarisierung der 50er Jahre immer noch gelang, die originale Inventareintragung zu finden. Bei den Bronzegegenständen kommt es vielleicht am häufigsten vor, daß weder bei der ersten, großen Revision noch später die originalen Inventarnummern entdeckt wurden, häufig nicht einmal die von publizierten Stücken....
| Műfaj | régészet |
| ISBN | 963-9046-36-1 |
| ISSN | 1217-632X |
| Sorozat | Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Series Archaeologica 3. |
| Kiadó | Magyar Nemzeti Múzeum |
| Kiadás éve | 1999 |
| Kötés típusa | Puhatáblás / Kartonált |
| Oldalszám | 253 |
| Nyelv | német |
| Méret | A4 205 x 287 |
| Tömeg | 500 g |